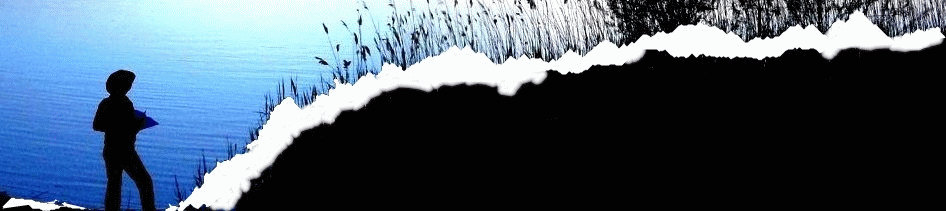
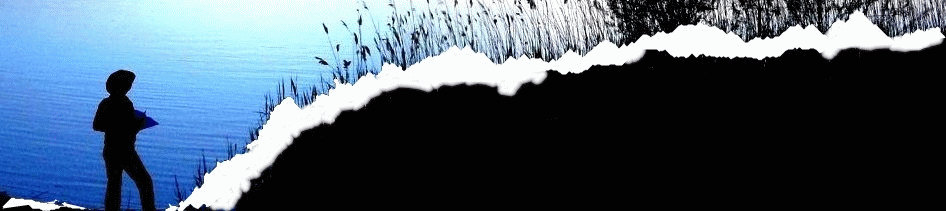 |
|
|
#1 |
|
Neuer Eiland-Dichter
Registriert seit: 03.09.2011
Beiträge: 15
|
Verwittert rascheln dunkelbraune Reben
des Weinstocks mit dem Winde sacht im Chor. Sie sprossen einst zu Helios empor und strebten, sich ins Firmament zu weben. Doch heute fehlt dem Weinstock alles Leben. Aus kranken Reben wob er Trauerflor und hat sich dadurch selbst als Grabdekor der Fäulnis und Verwesung übergeben. Allmählich legt der Himmel feinstes Vlies aus grauem Nebel über das Gefilde, das tief hinab ins Tal reicht, bis zum See. Und bald schon hüllt der Winter das Gebilde in einen weißen Sarkophag aus Schnee, auf dass sein Bruder finde, was er ließ. --- Letzter Vers: nachträglich geändert. dadurch: vorher ‚damit‘ Geändert von Odiumediae (07.09.2011 um 21:37 Uhr) |
|
|

|
|
|
#2 |
|
TENEBRAE
Registriert seit: 18.02.2009
Ort: Österreich
Beiträge: 8.570
|
Hi, Odi!
Wunderbar weicher Sprachfluss, akzelerierte Wortwahl, bildgewaltiges Kopfkino...solche Phrasen drängen sich da auf. Ihr Pathos würde aber dem harmonischen Gang deiner Poesie nicht gerecht - auch wenn du dich einer sehr klassischen Sprachhabung befleißigst (ich liiiebe das!), wirkt dein Gedicht nie pompös oder staksig, wie ich finde. Einzig bei der (ansonsten wunderbar gewebten) Conclusio habe ich einen kleinen Vorschlag: In der allerletzten Zeile heißt es: "was er ließ" - das bezieht sich wohl auf den Himmel, der Raureif auf's Gefilde legt, das wiederum von Schnee bedeckt wird, damit der Frühling die so konservierte Natur so vorfinde, was er (der Himmel des letzten Jahres) verloren hat. Kommt das in etwa hin? Nun, diese "Klammer" ist schon gewaltig und inhaltlich sehr verschachtelt - ich halte mich für relativ geschult in solchen Dingen, doch ich hatte eine Weile zu tun, um dem Gang des Sinnes diesen "Herbstnebel" zu folgen. Sollte allerdings der Winter mit dem "was er ließ" gemeint sein, ist die Klammer nachvollziehbarer, aber wie du merkst, kann es immer noch missverständlich sein. Mein Vorschlag daher: "damit der Frühling finde, was er hinterließ." "finde" finde ich einfach sprachmelodisch schöner als "findet", und es passt ebenso, ohne den Sinn zu ändern. Statt einer Tatsache beschwören wir eben die Möglichkeit... Und "hinterließ" macht diesen Satzteil allgemein verständlicher. Man kommt leichter drauf, was - und wer - gemeint ist, denke ich. Was hältst du davon? Sehr gern gelesen und beklugscheißert! LG, eKy
__________________
Weis heiter zieht diese Elend Erle Ute - aber Liebe allein lässt sie wachsen. Wer Gebete spricht, glaubt an Götter - wer aber Gedichte schreibt, glaubt an Menschen! Ein HAIKU ist ein Medium für alle, die mit langen Sätzen überfordert sind. Dummheit und Demut befreunden sich selten. Die Verbrennung von Vordenkern findet auf dem Gescheiterhaufen statt. Hybris ist ein Symptom der eigenen Begrenztheit. |
|
|

|
|
|
#3 | |
|
Neuer Eiland-Dichter
Registriert seit: 03.09.2011
Beiträge: 15
|
Entschuldigung, eKy!
Ich habe gerade einen kompletten Beitrag geschrieben, der durch meine Unachtsamkeit überflüssig geworden ist. Also nochmal: Zuerst gefiel mir Dein Vorschlag für den letzten Vers, aber dann merkte ich, dass der Vers dann zwölf Silben hat, dann kann ich in meiner etwas neurotischen Formstrenge nicht vereinen. Aber den Konjunktiv nehme ich gerne. Allerdings bleibt so noch immer die von Dir zu Recht bemängelte Missverständlichkeit. Ich denke, den letzten Vers so abändern: Zitat:
|
|
|
|

|
|
|
#4 |
|
TENEBRAE
Registriert seit: 18.02.2009
Ort: Österreich
Beiträge: 8.570
|
"auf dass sein Folger finde, was er ließ."
Wär auch eine denkbare Alternative, noch dazu sprachmelodisch harmonierend mit "finde". Denkbar auch, das "er" kursiv zu schreiben. Das würde die Betonung verstärken und auch auf den Winter hinweisen. LG, eKy
__________________
Weis heiter zieht diese Elend Erle Ute - aber Liebe allein lässt sie wachsen. Wer Gebete spricht, glaubt an Götter - wer aber Gedichte schreibt, glaubt an Menschen! Ein HAIKU ist ein Medium für alle, die mit langen Sätzen überfordert sind. Dummheit und Demut befreunden sich selten. Die Verbrennung von Vordenkern findet auf dem Gescheiterhaufen statt. Hybris ist ein Symptom der eigenen Begrenztheit. |
|
|

|
|
|
#5 |
|
Erfahrener Eiland-Dichter
Registriert seit: 15.03.2011
Ort: Stuttgart
Beiträge: 1.836
|
Hallo, Odiumediae,
willkommen auf Gedichte-Eiland.  Für mich erzählt dieses Sonett eine "Geschichte auf zwei Ebenen"; zum einen kann ich es als die unmittelbare Geschichte eines tatsächlichen Weinstocks und zum anderen als ein menschlichens Erleben verstehen. Die Gegenwart wird durch die ersten beiden Verse dargestellt. Danach folgt ein Rückblick in die Vergangenheit, als der Weinstock (der Mensch) noch jung war. Dabei sehe ich "grüne" Reben vor mir, die noch voller Kraft zur Sonne emporstreben, im Wunsch (vielleicht auch im Glauben), dass nur das Firnament die Grenze ist und alles erreicht werden kann. Im zweiten Quartett findet sich erneut die Gegenwart. Was erlebte der Weinstock, damit ihm "alles Leben" fehlt? Was ließ ihn erkranken? Emotional sehr stark (und sehr schön als Reim) wirken "Trauerflor" und "Grabdekor", die sich auch in ihrer Bedeutung ergänzen. "Fäulnis und Verwesung" - das ist schon beinahe "heftig". Demnach ist der Weinstock bereits "tot". Offenbar wurden alle Träume "begraben" und mit ihnen wohl auch die Hoffnung ... Ob meine Interpretation zutrifft, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, hier ist das "feinste Vlies aus grauem Nebel" als Metapher für das Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten gemeint. Wenn das bislang Erlittene zum "innerlichen Sterben" führte, kann der Verlust der Erinnerung durchaus eine Art "Erlösung" sein. "Tief hinab ins Tal, bis zum See" bedeutet m. E. nach "bis in die tiefsten Tiefen des Ichs". Der "Winter" umhüllt dann mit dem "Sarkophag aus Schnee", worin ich das Alter und den Tod sehe. Alles wird "zugedeckt". Der "Frühling", den du in "Bruder" umbenannt hast, versinnbildlicht die "Nachkommenden"; Kinder, vielleicht auch Enkelkinder. Sie "finden", was der Verstorbene hinterlassen hat. Die Terzette beschreiben den Übergang in die Zukunft, denke ich. Wenn ich den Titel in Bezug zum Inhalt setze, scheint mir der Wein(stock) bereits vor dem tatsächlichen Tod "erfroren" zu sein. Etwas möchte ich anmerken, allerdings nicht unbedingt als Kritik im eigentlichen Sinn: Die Jugend, die "gegenwärtige" Präsenz und die Zukunft. In diesem Sinne ist es stimmig. Aber mir "fehlt" hier irgendwie etwas. Der Weinstock ist krank, blickt auf die Jugend zurück, in der er stark und gesund war. Dann kehrt er erneut in die Gegenwart zurück, um bereits krank zu sein, zu verfaulen und zu sterben. Was mir hier fehlt, ist das "Warum?", wenn du verstehst, was ich meine ... Der Inhalt ist chronologisch einwandfrei, aber ich finde den "gefühlten Zugang" nur schwer, da ich mir beim Lesen nicht erklären kann, was sich ereignet hat, um zu Krankheit und Tod zu führen. Es fiele mir leichter, wenn es der kurzen Schilderung der Jugend entsprechend einen "Hinweis" gäbe, was sich "in der Zwischenzeit" ereignet hat bzw. eine "Empfindung" angedeutet wird. Ein Beispiel: Wenn jemand krank ist, habe ich natürlich Mitgefühl. Aber wenn mir mitgeteilt wird, es sei eine bestimmte, vielleicht sehr schlimme Krankheit, dann "vertieft" sich das unter Umständen beträchtlich. Mein emotionaler Bezug intensiviert sich. Das ist allerdings nur mein persönliches Gefühl!  Ganz kurz noch zu Quartett 2, Vers 3: damit wird xX betont, ein kleiner "Lapsus". Als Lösung könnte ich "deshalb", "demnach", "folglich" oder auch "ergo" anbieten. Dein Sonett gefällt mir sehr gut, besonders auch das Reimschema in den Terzetten. Der Himmel "umarmt" den Nebel und den Winter gemeinsam mit dem Frühling. Wirklich schön.  Ich persönlich finde, der "Frühling" ist besser, "Bruder" sagt mir weniger zu. Aber das ist reine "Geschmackssache", denn den inhaltlichen Zusammenhang fand ich in beiden Varianten ohne Probleme. Da ich noch nicht sehr lange "dichterisch" tätig bin, hoffe ich, dass ich im Sinne von Rhetorik und Sprache von dir lernen kann und auch, dass du eventuelle Fehler und Irrtümer meinerseits korrigierst. Es würde mich freuen. Sehr gerne gelesen und kommentiert. Liebe Grüße  Stimme 
__________________
.
|
|
|

|
|
|
#6 | |||
|
Neuer Eiland-Dichter
Registriert seit: 03.09.2011
Beiträge: 15
|
Den ‚Folger‘ finde ich nicht so gut, da er mir zu sehr nach einem Verfolger klingt, aber ich denke, das kursive ‚er‘ ist eine sehr gute Lösung, wenn keine endgültige, dann wird sie zumindest das Gemeinte erklären, bis ich eventuell eine Alternative für den letzten Vers gefunden habe.
Hallo! Und vielen Dank für den lieben Willkommensgruß! Zitat:
Auch was die Jahreszeiten angeht, hast Du meine Intention sehr gut erahnt. Die Farben spielen auch eine Rolle. Zu Beginn haben wir das Dunkelbraun, im zweiten Quartett soll durch den von Dir erwähnten Rückblick das einstige Grün beschworen werden, bis der Herbst und der Winter das Grau und Weiß bringen; ein Neubeginn, der ewige Kreislauf. Deshalb war mir auch der Grund für den Tod des Weinstocks nicht wichtig, denn er steht symbolisch für die Menschen. Würde ich das Schicksal individualisieren, ginge meines Erachtens der symbolische Effekt verloren, da man so nicht mehr leicht auf den Nebensinn stößt, wie es Dir gelungen ist. Zitat:
Zitat:
Ob Du etwas von mir lernen kannst, kann ich nicht sagen, aber Du hast mir bereits geholfen. Ich habe auch gerade Deinen Sonettkranz gesehen, den werde ich mir als Nächstes zu Gemüte führen. |
|||
|
|

|
|
|
#7 |
|
Erfahrener Eiland-Dichter
Registriert seit: 15.03.2011
Ort: Stuttgart
Beiträge: 1.836
|
Hallo, Odiumediae,
*räusper, hüstel*  mit "dadurch" ergibt sich dasselbe Problem: dadurch - xX. Damit, danach, somit, darauf, darum, mithin - alle: xX. Meine Vorschläge: deshalb - XX (also Xx), demnach - XX (also Xx), folglich - Xx, ergo - Xx. Ergänzend: hierdurch - Xx. Sinngemäß identisch mit dadurch. Akzeptabel?  "also" wäre zwar (Xx) rein betonungsbezogen eine Alternative, aber ich finde, sinnbezogen eher nicht. Nichts für ungut, ja?  Liebe Grüße  Stimme 
__________________
.
|
|
|

|
|
|
#8 | |||
|
Neuer Eiland-Dichter
Registriert seit: 03.09.2011
Beiträge: 15
|
Zitat:
 Ich habe das Problem erkannt, aber es ist schwer zu erklären, deshalb hoffe ich, es wird mir nicht als übertriebene Klugscheißerei ausgelegt. Wenn ich sagen würde: Zitat:
Wenn ich aber sagen würde: Zitat:
Das damit ist im ersten Beispiel eine Konjunktion, die rein kausal steht. Im zweiten Beispiel wird es hingegen zu einem Pronominaladverb, es steht hier als Pronomen für einen abstrakten Begriff. In meinem Gedicht erfüllen sowohl das Wort damit als auch sein Synonym dadurch also die Funktion eines Pronominaladverbs. Zunächst war mir der Unterschied selbst nicht klar, ich habe, nachdem Du es angemerkt hast, das Gefühl gehabt, es stimme etwas nicht. Erst als ich genauer hingesehen habe, ist mir der Unterschied aufgefallen und dass ich das Wort in Abhängigkeit von seinem semantischen Kontext betone. Ich weiß nicht, warum ich so spreche, es könnte mein Idiolekt oder dialektal bedingt sein, vielleicht handelt es sich aber auch nur um ein Missverständnis und die meisten Menschen würden in der gesprochenen Sprache automatisch diesen Unterschied machen. Jedenfalls würde mich interessieren, was Du dazu denkst und ob Du meine Erklärung nachvollziehen kannst. Geändert von Odiumediae (09.09.2011 um 13:06 Uhr) |
|||
|
|

|
|
|
#9 |
|
TENEBRAE
Registriert seit: 18.02.2009
Ort: Österreich
Beiträge: 8.570
|
Verstehen würde ich es, schriebest du nicht, es wäre zum einen ein Pronominaladverb und zum anderen ein...Pronominaladverb.
DAS ist dann doch etwas verwirrend...
__________________
Weis heiter zieht diese Elend Erle Ute - aber Liebe allein lässt sie wachsen. Wer Gebete spricht, glaubt an Götter - wer aber Gedichte schreibt, glaubt an Menschen! Ein HAIKU ist ein Medium für alle, die mit langen Sätzen überfordert sind. Dummheit und Demut befreunden sich selten. Die Verbrennung von Vordenkern findet auf dem Gescheiterhaufen statt. Hybris ist ein Symptom der eigenen Begrenztheit. |
|
|

|
|
|
#10 |
|
Neuer Eiland-Dichter
Registriert seit: 03.09.2011
Beiträge: 15
|
|
|
|

|
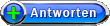 |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
 Ähnliche Themen
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Neuer Wein | Blaugold | Auf der Suche nach Spiritualität | 2 | 18.08.2011 19:16 |
| Sternenschein und roter Wein | Chavali | Ausflug in die Natur | 11 | 14.04.2010 22:23 |
| Wie Wein | a.c.larin | Minimallyrik und Aphorismen | 6 | 11.06.2009 00:08 |
| Johnny und der Wein | Feirefiz | Vertonte Gedichte | 11 | 24.05.2009 10:58 |