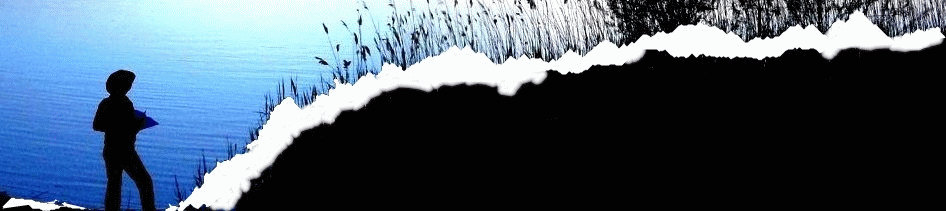
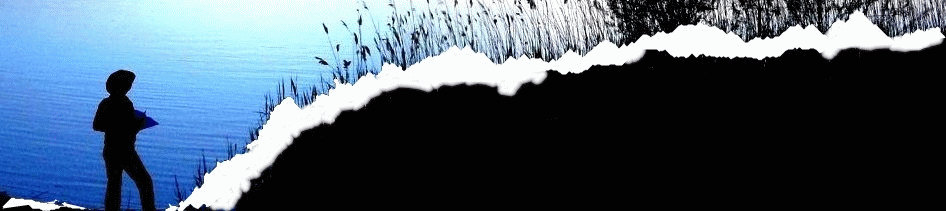 |
|
|
|
|
#1 |
|
Lyrische Emotion
Registriert seit: 07.02.2009
Ort: Inselstadt Ratzeburg
Beiträge: 10.009
|
Fenster zur Wahrheit Über Wahrnehmung, Weltbilder und die Versuchung des Glaubens Vorwort Dieses Werk ist aus dem Bedürfnis entstanden, über die Begrenztheit unserer Wahrnehmung und die Versuchung geschlossener Weltbilder nachzudenken. Es ist kein wissenschaftlicher Traktat, sondern eine philosophische Reflexion, gewachsen aus persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen. Der Text will nicht belehren, sondern öffnen. Er will keine fertigen Antworten geben, sondern Fragen stellen. Wer ihn liest, möge ihn nicht als Angriff verstehen, sondern als Einladung zum eigenständigen Denken. Denn Philosophie beginnt dort, wo wir bereit sind, unser Nichtwissen ernst zu nehmen und die Vielfalt der Perspektiven zu respektieren. Zwei Prologe und zwei Epiloge rahmen die Abhandlung. Sie sind nicht als Konkurrenz gedacht, sondern als Ergänzung. Der erste Prolog und Epilog sprechen in einer klaren, offenen Sprache, die den Leser unmittelbar einlädt. Der zweite Prolog und Epilog greifen die Tradition der klassischen Philosophie auf und formulieren die Gedanken in dichterer, anspruchsvollerer Weise. Beide Fassungen sind gleichwertig und zeigen, dass dieselben Gedanken in unterschiedlichen Sprachwelten Gestalt gewinnen können: einmal als Einladung zum Dialog, einmal als Reflexion im Geiste der Philosophen. Der Leser möge selbst entscheiden, welche Stimme ihn stärker anspricht – oder beide nebeneinander hören, um die Vielfalt der Ausdrucksformen zu genießen. Denn Wahrheit ist kein Besitz, sondern Beziehung, und sie lebt im Gespräch zwischen den Stimmen. Prolog - Einladung Diese Abhandlung ist kein Urteil, kein Angriff und keine fertige Wahrheit. Sie ist ein Versuch, über die Begrenztheit unserer Wahrnehmung und die Versuchung geschlossener Weltbilder nachzudenken. Jeder Mensch sieht die Welt durch sein eigenes Fenster, und jeder glaubt, dass sein Blick der richtige sei. Doch was geschieht, wenn wir erkennen, dass unser Fenster nur ein Ausschnitt ist? Die folgenden Gedanken wollen nicht überzeugen, sondern anregen. Sie wollen nicht belehren, sondern öffnen. Wer sie liest, möge sie nicht als fertige Antwort nehmen, sondern als Einladung, selbst zu prüfen, zu zweifeln, zu fragen. Denn Philosophie beginnt nicht dort, wo wir glauben, alles zu wissen, sondern dort, wo wir bereit sind, unser Nichtwissen ernst zu nehmen. Prolog - Tradition Der Mensch ist, in seiner Erkenntnis, stets an die Bedingungen seiner eigenen Anschauung gebunden. Was ihm erscheint, ist niemals das Ding an sich, sondern nur die Erscheinung, vermittelt durch die Formen seiner Sinnlichkeit und die Begriffe seines Verstandes. Gleichwohl neigt er dazu, das Gegebene für das Ganze zu halten, den Ausschnitt für die Totalität, das Fenster für die Welt. Diese Abhandlung will nicht Wahrheit verkünden, sondern die Grenzen des menschlichen Erkennens sichtbar machen. Sie will zeigen, dass die Sehnsucht nach einem absoluten Weltbild – sei es religiöser oder anderer Art – aus eben jener Begrenztheit entspringt, die wir nicht überwinden können. Der Leser möge sich nicht in der Erwartung einer endgültigen Antwort verlieren, sondern in der Übung des Denkens, das sich seiner eigenen Schranken bewusst bleibt.
__________________
Oh, dass ich große Laster säh', Verbrechen, blutig kolossal, nur diese satte Tugend nicht und zahlungsfähige Moral. (Heinrich Heine) Für alle meine Texte gilt: © Falderwald --> --> --> --> --> Wichtig: Tipps zur Software |
|
|

|
|
|
#2 |
|
Lyrische Emotion
Registriert seit: 07.02.2009
Ort: Inselstadt Ratzeburg
Beiträge: 10.009
|
Teil I – Das Fenster als Metapher Jeder Mensch lebt in einem Raum, der von Fenstern begrenzt ist. Wir treten an das Glas, schauen hinaus und glauben, die Welt zu sehen. Doch was wir sehen, ist niemals die Welt in ihrer Gesamtheit, sondern nur ein Ausschnitt, ein begrenzter Blickwinkel. Das Fenster ist unsere Perspektive, unsere Position, unsere Wahrnehmung. Wenn wir den Platz wechseln, verändert sich der Blick. Wir sehen andere Dinge, andere Muster, andere Zusammenhänge. Aber auch dann bleibt es nur ein Teil, niemals das Ganze. Kein Mensch kann den 360°-Blick haben, kein Mensch kann alle Fenster gleichzeitig öffnen. Wir sind immer gebunden an unsere Sicht, unsere Begrenzung. Diese Metapher ist mehr als ein Bild: Sie ist eine Wahrheit über die menschliche Existenz. Wir leben nicht in der Welt, wie sie „an sich“ ist, sondern in der Welt, wie sie uns erscheint. Unsere Fenster sind unsere Sinne, unsere Erfahrungen, unsere Sprache, unsere Kultur. Sie filtern, sie formen, sie begrenzen. Und wir halten das, was wir sehen, für die Realität. Doch Realität ist größer als unser Blick. Sie ist nicht nur das, was wir sehen, sondern auch das, was wir nicht sehen. Sie ist nicht nur das, was wir verstehen, sondern auch das, was uns verborgen bleibt. Wer das vergisst, wer sein Fenster für das einzige gültige erklärt, der verwechselt den Ausschnitt mit dem Ganzen. Teil II – Subjektive Wahrnehmung: Farben als Beispiel Meine eigene Wahrnehmung zeigt dies besonders deutlich. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Für mich erscheinen bestimmte Farben anders, als sie von der Mehrheit gesehen werden. Als Kind habe ich das Gras im Sonnenlicht als orange wahrgenommen. Für mich war das keine Täuschung, sondern Realität. Es war meine ehrliche Sicht auf die Welt. Dieses Beispiel verdeutlicht: Wahrnehmung ist subjektiv. Sie ist echt, aber nicht universell. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt der Eindrücke. Was für den einen selbstverständlich ist, kann für den anderen völlig anders erscheinen. Die Philosophen haben dies seit Jahrhunderten bedacht. Schon Kant sprach davon, dass wir die Dinge nicht „an sich“ erkennen, sondern nur so, wie sie uns erscheinen. Unsere Sinne sind die Fenster, durch die wir blicken. Sie geben uns nicht die Welt, sondern ein Bild der Welt. Die Farben sind nur ein Beispiel. Auch Geräusche, Gerüche, Erinnerungen, Gefühle – all das ist subjektiv. Jeder Mensch trägt seine eigene Wirklichkeit in sich. Und doch glauben wir oft, dass unsere Sicht die einzige richtige sei. Wir vergessen, dass andere Fenster andere Bilder zeigen. Die Konsequenz ist klar: Absolute Wahrheit ist für uns unerreichbar. Wir leben in Interpretationen, nicht in objektiven Gesamteindrücken. Und genau hier beginnt die Versuchung des Glaubens – die Sehnsucht nach einer Wahrheit, die größer ist als unser Fenster, die Sehnsucht nach einem Ganzen, das wir niemals sehen können. Teil III – Die Grenzen der Wahrheit Wenn wir anerkennen, dass jeder Mensch nur durch sein eigenes Fenster blickt, dann erkennen wir zugleich die Grenzen unserer Wahrheit. Wahrheit ist kein Besitz, den man einmal erlangt und für immer festhält. Wahrheit ist ein Prozess, ein Annähern, ein ständiges Korrigieren und Erweitern des Blicks. Doch die Sehnsucht nach einer absoluten Wahrheit ist tief im Menschen verankert. Wir möchten glauben, dass es „die eine“ Erklärung gibt, die alles zusammenfasst, die uns Sicherheit gibt, die uns von der Mühsal des Zweifelns befreit. Diese Sehnsucht ist verständlich, aber gefährlich. Denn sie öffnet die Tür für Weltbilder, die sich als endgültig ausgeben, obwohl sie nur ein Ausschnitt sind. Die Philosophie hat seit jeher versucht, diese Sehnsucht zu zügeln. Sie erinnert uns daran, dass wir nicht die Dinge „an sich“ erkennen, sondern nur die Erscheinungen. Sie mahnt uns, dass unser Wissen immer begrenzt ist. Doch viele Menschen wollen diese Begrenzung nicht akzeptieren. Sie suchen nach Erzählungen, die ihnen die Illusion einer vollständigen Wahrheit schenken. Hier beginnt die Versuchung des Glaubens: die Bereitschaft, ein geschlossenes Weltbild zu akzeptieren, das alle Fragen beantwortet – und sei es um den Preis der Vernunft. Teil IV – Starre Weltbilder und die Parallelen zu Religion und Glauben Starre Weltbilder sind wie Räume ohne Türen. Sie erlauben keinen Blick hinaus, keinen Zweifel, keinen Dialog. Wer in einem solchen Raum lebt, hält sein Fenster für das einzige gültige und erklärt alle anderen für falsch oder manipuliert. Religionen und Glaubenssysteme sind klassische Beispiele für solche Räume. Sie beruhen auf Überzeugungen, die sich nicht aus Erfahrung oder Beweisen ableiten, sondern aus Vertrauen, Tradition oder Autorität. Sie immunisieren sich gegen Kritik: Wer zweifelt, gilt als Ungläubiger, wer widerspricht, als Verführter. Doch diese Struktur findet sich nicht nur in Religionen. Auch andere geschlossene Weltbilder funktionieren nach demselben Muster. Sie bieten einfache Antworten auf komplexe Fragen, sie stiften Sinn, sie geben Halt. Aber sie tun dies, indem sie die Vielfalt der Fensterblicke leugnen und sich selbst zur absoluten Wahrheit erklären. Die Gefahr liegt darin, dass solche Weltbilder nicht nur den Einzelnen binden, sondern auch Gemeinschaften formen, die sich gegen jede andere Sicht abschotten. Sie schaffen ein „Wir“ gegen „die Anderen“, ein Gefühl der Auserwähltheit, das jede Kritik abwehrt. So wird der Dialog unmöglich. Wer glaubt, die ganze Wahrheit zu besitzen, hört nicht mehr zu. Wer sein Fenster für das einzige erklärt, verschließt sich der Welt. Teil V – Motivation und Nutzen Wenn wir die Struktur geschlossener Weltbilder betrachten, stellt sich unweigerlich die Frage: Wem nützt das? Denn kein Weltbild entsteht im luftleeren Raum. Es wird getragen, verbreitet, gepflegt – und oft verfolgt es bestimmte Ziele. Manche Menschen finden darin Halt und Sinn. Sie fühlen sich durch ein geschlossenes System geborgen, weil es ihnen einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt. Doch hinter dieser persönlichen Ebene stehen häufig auch handfeste Interessen. • Macht und Einfluss: Wer ein geschlossenes Weltbild verbreitet, gewinnt Anhänger. Er schafft eine Gemeinschaft, die ihm folgt, die ihn bestätigt, die ihn stärkt. • Finanzielle Vorteile: Nicht selten werden solche Systeme durch Spenden oder andere Zuwendungen gestützt. Der Glaube wird zur Ressource, die sich in Geld verwandeln lässt. • Geltungsbedürfnis: Manche Menschen sehnen sich danach, etwas Besonderes zu wissen, „eingeweiht“ zu sein. Ein geschlossenes Weltbild gibt ihnen das Gefühl, über anderen zu stehen. • Unzufriedenheit mit bestehenden Systemen: Wer sich von Politik, Gesellschaft oder Wissenschaft enttäuscht fühlt, sucht nach Alternativen. Geschlossene Weltbilder bieten eine Flucht, eine Gegenwelt, die vermeintlich besser erklärt, was geschieht. Die Attraktivität solcher Systeme liegt darin, dass sie Sinn stiften. Sie verwandeln Unsicherheit in Gewissheit, Komplexität in Einfachheit, Zweifel in Glauben. Doch dieser Gewinn ist trügerisch: Er wird erkauft mit dem Verlust der Offenheit, mit dem Verzicht auf den Dialog, mit der Abkehr von der Vielfalt der Fensterblicke. Teil VI – Logik und Realitätstest Ein weiteres Mittel, geschlossene Weltbilder zu prüfen, ist die Logik. Viele Behauptungen scheitern schon an der praktischen Umsetzbarkeit. Nehmen wir ein Beispiel: Es wird behauptet, eine unsichtbare Kraft oder Technologie kontrolliere die Gedanken der Menschen. Wenn dies tatsächlich der Fall wäre, müsste eine unüberschaubare Zahl von Menschen in dieses Geheimnis eingeweiht sein – Entwickler, Techniker, Wissenschaftler, Politiker. Es wäre unmöglich, dass nichts davon durchsickert. Je größer die behauptete Verschwörung, desto unwahrscheinlicher ihre Geheimhaltung. Die Realität selbst entlarvt solche Konstruktionen. Denn die Welt ist durchlässig. Informationen fließen, Menschen reden, Geheimnisse werden verraten. Die Vorstellung, dass ein gigantisches System über Jahrzehnte hinweg vollkommen verborgen bleiben könnte, widerspricht der Erfahrung. Der Realitätstest ist daher ein wirksames Mittel: Man muss sich fragen, wie plausibel eine Behauptung ist, wenn man die praktischen Bedingungen bedenkt. Wie viele Menschen müssten beteiligt sein? Wie lange müsste das Geheimnis gewahrt bleiben? Wie wahrscheinlich ist es, dass niemand jemals glaubwürdige Beweise liefert? Die Antwort ist meist ernüchternd: Je größer die Behauptung, desto geringer ihre Wahrscheinlichkeit. Und doch halten viele Menschen an solchen Ideen fest – nicht, weil sie logisch sind, sondern weil sie Sinn stiften. Teil VII – Aufdecken von Irrationalität Das Wort „irrational“ hat im Alltag einen negativen Klang. Es bedeutet für viele Menschen: unvernünftig, unsinnig, unlogisch. Doch die Mathematik zeigt uns, dass Irrationalität nicht gleich Unsinn ist. Es gibt Zahlen, die wir „irrationale Zahlen“ nennen – wie die Wurzel aus 2 oder die Zahl π. Sie lassen sich nicht als Bruch zweier ganzer Zahlen darstellen, ihre Nachkommastellen sind unendlich und nicht periodisch. Und doch sind sie unverzichtbar für die Ordnung der Mathematik. Ohne sie könnten wir keine Kreise berechnen, keine Diagonalen messen, keine Brücken bauen. Dieses Beispiel ist lehrreich: Irrationalität kann Teil einer konsistenten Ordnung sein. Sie ist nicht das Gegenteil von Vernunft, sondern eine Erweiterung unseres Verständnisses. Wir akzeptieren sie, weil sie sich in der Praxis bewährt, weil sie sich in der Erfahrung bestätigt. Ganz anders verhält es sich mit irrationalem Denken in geschlossenen Weltbildern. Dort wird Irrationalität nicht als mathematische Notwendigkeit verstanden, sondern als Flucht vor der Vernunft. Sie dient dazu, Widersprüche zu überdecken, Kritik abzuwehren, Zweifel zu ersticken. Sie wird nicht akzeptiert, weil sie sich bewährt, sondern weil sie bequem ist. Der Unterschied ist entscheidend: Wissenschaft benennt und akzeptiert Irrationalität, wo sie notwendig ist. Geschlossene Weltbilder missbrauchen sie, um Unvernunft zu rechtfertigen. Wer diesen Unterschied erkennt, kann beginnen, die Grenzen zwischen echter Erkenntnis und bloßer Behauptung zu ziehen. Teil VIII – Philosophische Konsequenz Wenn wir all dies bedenken – die Begrenzung unserer Fenster, die Subjektivität unserer Wahrnehmung, die Sehnsucht nach absoluter Wahrheit, die Versuchung geschlossener Weltbilder, die Motivation ihrer Verbreitung und die Irrationalität ihrer Argumente –, dann ergibt sich eine klare Konsequenz: Offenheit ist die einzige Haltung, die uns vor dem Gefängnis der starren Wahrheit bewahrt. Offenheit bedeutet, andere Fensterblicke zu akzeptieren, auch wenn sie nicht die eigenen sind. Es bedeutet, die Vielfalt der Perspektiven zu respektieren, auch wenn sie uns fremd erscheinen. Es bedeutet, den Zweifel nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Stärke – als die Kraft, die uns davor schützt, in geschlossenen Räumen zu verharren. Wer glaubt, die ganze Wahrheit zu besitzen, verliert die Fähigkeit zum Dialog. Wer sein Fenster für das einzige erklärt, verschließt sich der Welt. Doch wer anerkennt, dass sein Blick begrenzt ist, öffnet sich für die Möglichkeit, von anderen zu lernen. Die Freiheit liegt nicht darin, die absolute Wahrheit zu kennen. Sie liegt darin, die Vielfalt der Fensterblicke zu respektieren und in der Demut zu leben, dass wir niemals das Ganze sehen werden. Diese Demut ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Sie schützt uns vor der Versuchung des Glaubens, sei es in Religion oder in geschlossenen Weltbildern, und öffnet uns für die Vielfalt der Welt, die wir nur gemeinsam erahnen können. Teil IX – Schlussgedanken Die Welt liegt vor uns wie eine Landschaft, die wir durch viele Fenster erahnen: fragmentiert, wechselhaft, schön und widersprüchlich. Wir wünschen uns so oft den einen Aussichtspunkt, von dem aus man alles überblickt, ein Plateau der Gewissheit, das uns Ruhe schenkt und alle Fragen beantwortet. Doch dieses Plateau existiert nicht. Was existiert, sind Wege – Pfade zwischen Fenstern, Übergänge von Blick zu Blick, Gespräche von Mensch zu Mensch. Der Schluss dieser Abhandlung ist daher kein Ende, sondern eine Einladung: zur Bewegung, zum Dialog, zur Demut und zur Freiheit im Unvollständigen.
• Fragen: Was sehe ich noch nicht? Wer könnte mir helfen, es zu sehen? • Prüfen: Besteht meine Erzählung die Wirklichkeitstests? • Korrigieren: Bin ich bereit, meinen Blick zu verändern, wenn gute Gründe es nahelegen? • Teilen: Erzähle ich so, dass andere mitdenken können, statt nur zuzustimmen? Diese fünf schlichten Bewegungen sind kein System, sondern eine Haltung. Sie machen aus Fenstern keine Mauern, aus Räumen keine Gefängnisse, aus Menschen keine Gegner.
Lass uns also nicht nach dem einen Fenster suchen, das alles zeigt. Lass uns Fenster aneinanderlegen, Pfade dazwischen bauen, Stimmen hören, die anders klingen, und Geschichten erzählen, die Prüfungen bestehen. In dieser stillen, beharrlichen Praxis findet der Glauben an starre Gewissheiten keine Nahrung – und die Vernunft, bescheiden und menschlich, bekommt Raum. Das Ganze wird uns nie gehören. Aber wir können ihm näherkommen, Schritt für Schritt, Blick für Blick, miteinander.
__________________
Oh, dass ich große Laster säh', Verbrechen, blutig kolossal, nur diese satte Tugend nicht und zahlungsfähige Moral. (Heinrich Heine) Für alle meine Texte gilt: © Falderwald --> --> --> --> --> Wichtig: Tipps zur Software |
|
|

|
|
|
#3 |
|
Lyrische Emotion
Registriert seit: 07.02.2009
Ort: Inselstadt Ratzeburg
Beiträge: 10.009
|
Epilog - Ausblick Wir haben durch viele Fenster geblickt: durch die Farben der Wahrnehmung, durch die Grenzen der Wahrheit, durch die Räume geschlossener Weltbilder, durch die Versuchung des Glaubens und die Kraft des Zweifels. Was bleibt, ist keine absolute Erkenntnis, sondern eine Haltung. Diese Haltung heißt Offenheit. Sie bedeutet, die Vielfalt der Perspektiven zu respektieren, den Zweifel als Freund zu sehen und die Wirklichkeit als Prüfstein zu akzeptieren. Sie bedeutet, Sinn nicht in starren Erzählungen zu suchen, sondern im gemeinsamen Gespräch, im Teilen der Ausschnitte, im Erkennen der Begrenzung. Vielleicht ist das die eigentliche Freiheit: nicht die Sicherheit einer fertigen Wahrheit, sondern die Demut, im Fragment zu leben und dennoch Hoffnung zu haben. Hoffnung, dass wir durch viele Fensterblicke gemeinsam mehr sehen können, als einer allein. So endet diese Abhandlung nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Komma – als Einladung, weiterzudenken, weiterzufragen, weiterzusehen. Epilog - Reflexion Das Leben des Menschen ist ein fortwährender Versuch, dem Chaos der Erscheinungen einen Sinn abzuringen. Er baut Systeme, er schafft Erzählungen, er klammert sich an Glaubenssätze, um dem Strom der Welt eine Richtung zu geben. Doch all dies ist, im Grunde, nur der Schleier des Willens, der sich selbst zu erkennen sucht und dabei in Bildern und Begriffen verstrickt bleibt. Wer glaubt, die Wahrheit besitze er, ist in Wahrheit nur Gefangener seines eigenen Willens. Wer hingegen die Begrenztheit seiner Erkenntnis anerkennt, gewinnt eine Freiheit, die nicht in der Gewissheit liegt, sondern in der Demut. Denn die Welt ist nicht dazu da, uns zu bestätigen, sondern uns zu prüfen. So endet diese Abhandlung nicht mit einem Triumph der Vernunft, sondern mit der Einsicht ihrer Grenzen. Der Leser möge daraus nicht Resignation schöpfen, sondern jene stille Stärke, die darin liegt, das Fragment zu akzeptieren und dennoch weiterzudenken. Denn im Fragment liegt die Wahrheit des Menschen – und im Zweifel ihre Würde. Nachwort Diese Abhandlung ist ein Versuch, die Grenzen unserer Erkenntnis sichtbar zu machen und zugleich die Würde des Fragments zu betonen. Wir werden niemals den 360°-Blick haben, doch wir können lernen, die Muster unserer Wahrnehmung zu erkennen und uns davor zu bewahren, starre Weltbilder als absolute Wahrheit zu nehmen. Der Text versteht sich als Beitrag zum Dialog. Er will nicht das letzte Wort sprechen, sondern ein Komma setzen – als Einladung, weiterzudenken, weiterzufragen, weiterzusehen. Vielleicht liegt die eigentliche Freiheit des Menschen nicht darin, alles zu wissen, sondern darin, zu akzeptieren, dass er nicht alles wissen kann. In dieser Demut liegt Stärke. Sie schützt uns vor der Versuchung des Glaubens und öffnet uns für die Vielfalt der Welt, die wir nur gemeinsam erahnen können. Wer diesen Text liest, möge ihn nicht als abgeschlossene Wahrheit nehmen, sondern als einen Fensterblick, der sich zu anderen gesellt. Denn nur im Mosaik vieler Fenster entsteht ein Bild, das größer ist als der Einzelne. Anhang Literaturhinweise Die Gedanken dieser Abhandlung stehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind inspiriert und begleitet von Stimmen der Philosophie, die seit Jahrhunderten über Wahrnehmung, Wahrheit und Weltbilder nachdenken: • Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (1781/1787) – zur Begrenztheit menschlicher Erkenntnis und dem Unterschied zwischen Erscheinung und Ding an sich. • Ludwig Wittgenstein: Über Gewissheit (1950/51) – zur Rolle von Weltbildern als Rahmen unseres Denkens. • Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) – zur Bedeutung des Willens und der Begrenztheit unserer Wahrnehmung. • Stefan Hepfer: Weltbilder und Wirklichkeit (2015) – zur Analyse moderner Weltbilder und ihrer Funktion. Diese Hinweise sind keine Quellen im engeren Sinn, sondern Wegmarken, die zeigen, dass die hier entwickelten Gedanken im Gespräch mit einer langen Tradition stehen. Dank Mein Dank gilt allen Stimmen, die mich durch Gespräche, Fragen und Schriften begleitet haben. Ohne sie wäre dieser Text nicht entstanden. Hinweis zur Entstehung Die Abhandlung ist aus persönlichen Reflexionen und Beobachtungen hervorgegangen. Sie versteht sich nicht als wissenschaftlicher Traktat, sondern als philosophische Meditation, die Bilder und Gedanken anbietet, um zum Weiterdenken einzuladen. Falderwald . .. . 2025
__________________
Oh, dass ich große Laster säh', Verbrechen, blutig kolossal, nur diese satte Tugend nicht und zahlungsfähige Moral. (Heinrich Heine) Für alle meine Texte gilt: © Falderwald --> --> --> --> --> Wichtig: Tipps zur Software |
|
|

|
|
|
#4 |
|
Erfahrener Eiland-Dichter
Registriert seit: 12.09.2023
Ort: Kalawa, dem Sumpfgebiet, auch Calau dem Wortsportort und https://www.youtube.com/@Cilonsar
Beiträge: 149
|
ich gestehe ich habe nicht alles gelesen, da ich direkt erinnert war an eines meiner Werke, weil Du schreibst im Vorwort:
"Dieses Werk ist aus dem Bedürfnis entstanden, über die Begrenztheit unserer Wahrnehmung und die Versuchung geschlossener Weltbilder nachzudenken" https://www.gedichte-eiland.de/showthread.php?t=23215 Dies "Verflucht" müsste für Dich auch wieder lächerlich sein, ich zumindest konnte jetzt mal wieder lachen. Eventuell lese ich in Bälde alle diese Texte hier in diesem Thread, denn dass Thema ist in Anzahl an Beispielen, die witzig sind, kaum zu übertreffen und Du weisst ja, dass ich Selbstinszenierung lustig finde und zur Krönung auch noch "Identifikations-Karma" nenne. Bis Bald Noire der Noah |
|
|

|
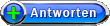 |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
 Ähnliche Themen
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Sterne - die Wahrheit 1 | ralfchen | Bei Vollmond | 0 | 02.10.2022 14:35 |
| die Wahrheit | juli | Denkerklause | 4 | 26.02.2014 19:55 |
| Wahrheit | Ibrahim | Denkerklause | 4 | 06.05.2009 09:20 |