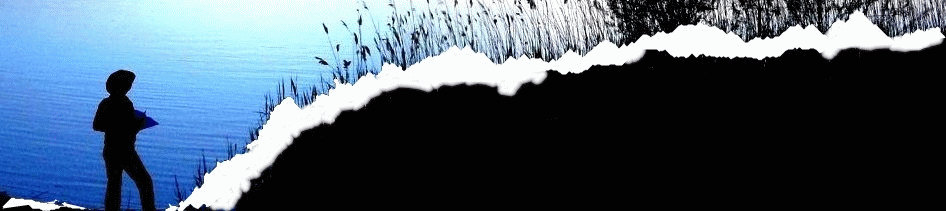
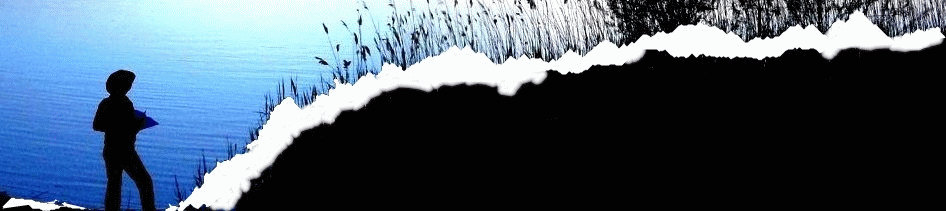 |
Ist Metrum mehr als die Leinwand? Shakespeare-Sonett 12
Liebe Freunde und Skeptiker
Zum Teil werde ich hier in Metrikfragen auf eine Weise belehrt, welche mich nicht befriedigt. Einige erinnern sich vielleicht an meinen Scherz mit Goethes Knittelvers. Diesmal zitiere ich ganz offen Shakespeare. Mit dem gleichen Ziel: Meinungen zu erfahren, klüger zu werden oder im anderen Fall meine eigene Meinung verstehbarer zu machen. Ist "Metrum" mehr als die Leinwand, auf die der Dichter seine Verse malt?, lautet meine Frage. Will heissen: Zeigt dieses Sonett von Sh. nicht eben gerade, dass der grosse Meister bewusst mit dem Metrum spielte, den 5-hebigen Iambus im Interesse der Variation auch mal durchbrach? (oder anders: auf die Leinwand seine Pinselstriche nach eigenem ästhetischem Empfinden setzte. Oder ist es vielleicht so, dass der Meister Sh. ein Verständnis von "Betonung" hatte, welches mir schlicht nicht gegeben ist? Und was denn für eines? Unten nun das Sonett mit Fettschriftmarkierung jener Zeilen, welche mMn klar das Metrum brechen. (an anderen Stellen, wo mMn nicht wirklich ein Verstoss gegen das Metrum vorliegt, habe ich nur Klammern gesetzt). Wäre toll, wenn ich eure Meinung erfahren dürfte. Gute nNcht wolo 1 When I doe count the clock that tels the time, XxxXxXxXxX 2 And see the braue day sunck in hidious night, xXxXXXxXxxX 3 When I behold the violet past prime, XxxXxXxxxX 4 And sable curls or siluer'd ore with white: xXxXxXx(x)XxX 5 When lofty trees I see barren of leaues, XXxXxXX(x)xX 6 Which erst from heat did canopie the herd xXxXxXxxxX 7 And Summers greene all girded vp in sheaues xXxXxXxXxX 8 Borne on the beare with white and bristly beard: XxxXxXxXxX 9 Then of thy beauty do I question make XxxXx(X)xXxX 10 That thou among the wastes of time must goe, xXxXxXxXxX 11 Since sweets and beauties do them-selues forsake, xXxXx(X)xXxX 12 And die as fast as they see others grow, xXxXx(X)xXxX 13 And nothing gainst Times sieth can make defence xXxXXXxXxX 14 Saue breed to braue him, when he takes thee hence. xXxXxXXXx(X) |
die erste Zeile hat, Wolo genau das, was ich an anderer Stelle mit Akzentuierung meinte.
das verstärkende do (count), was ja nur als poetische Verstärkung geht, ansonsten müsste es ja heißen ( I count) ist typisch für SHP.. Somit wird hier das I betont. Sozusagen: wenn ich die Zeit angebe, nicht die Uhr... DAS genau meinte ich mit Metrum passend zum Inhalt setzen( als Stil-Mittel). Dennoch ist der Jambus hier richtig. Das Gedicht ist metrisch ok, bis auf die Zeile "when lofty trees... hier habe ich mit der Betonung von barren, was normalerweise auf bar betont wird eine Unebenheit. Ob das nun um SHP Zeiten noch anders betont wurde oder einene dialektale Unebenheit ist,weiß ich nicht, da diachronische Sprachforschung im Englischen nicht zu meinen Studiengängen gehörte. Ansonsten hätte SHP hier, was ich mir nicht vorstellen kann, einen Holperer drin. Meine bescheidene Meinung, aber wir haben ja hier Spezialisten, die dir deine Fragen sicherlich umfassend beantworten können, falls ihr Englisch dafür ausreicht...:Blume: LG von Agneta |
Hallo Wolo,
ich tendiere (außer in V5 und V14) eher zu Deiner Lesart. Zwar kenne ich mich mit Shakespeare nicht besonders aus, es scheint mir aber, als habe er hier die versetzte Betonung als metrische Lizenz ausgiebig genutzt. Eine solche Lizenz ist z.B. auch V3: violet past prime (XxxxX). Aber - huch, was sehe ich denn da? 5 When lofty trees I see barren of leaues, xXxXxXXxxX Das kommt mir doch bekannt vor! Ich vergleiche: ein auto schleicht auf samtpfoten vorbei xXxXxXXxxX Sensationell! LG Claudi |
Einer, von dem ich in den Dichter-"Netzen" immer wieder eine Menge lernen kann (oder könnte, nähme ich mir genügend Zeit), ist "ferdi".
Er hat unter dem unten stehenden link auf die Frage, welche ich hier stelle, eine interessante Antwort gegeben, welche ich persönlich für lesenswert halte. https://www.gedichte.com/showthread....760#post924760 Hallo Claudi Bei V5 widerrufst du also? Bei V14 kann das "he" unmöglich eine Senkung sein. Gut, da ist ein langer Vokal, aber danach folgt nur ein Plosionslaut. Und der lange Vokal wird ja so lang, weil er eben von der Bedeutung her stark gestresst wird. (scythe ist nämlich feminin, habe noch eigens nachgeschaut). Danke für dein Interesse! wolo Hallo Agneta Mal zur ersten Zeile: Wir sind uns einig, dass das doe einen Akzent setzt. Nun sage ich weiter: Das I trägt keinen Akzent. Demnach kann man diesen Vers so darstellen, wie ich es getan habe. Oder vielleicht so: xx(X)XxXxXxX Auf jeden Fall spielt er gleich zu Anfang in freier Weise mit Rhythmus und Metrum. Danke für deine Auseinandersetzung mit meinem "Problem". wolo |
Lieber Wolo,
es gibt offensichtliche Anzeichen dafür, dass die Aussprache zu Shakespears Zeit nicht ganz der heutigen entspricht. Trotzdem stimmt meiner Meinung nach Agnetas Kommentar, d.h. das Metrum ist "korrekt", mit Ausnahme der von ihr benannten Zeile. Ich denke, man muss "barren" mit dem Ton auf der ersten Silbe sprechen, auch scheint mir der "verbotene Zusammenprall" zweier betonter Silben hier eine gute Wirkung zu tun, Ich sage das so vage als meine Meinung, weil ich mir nicht die Arbeit machen möchte, es zu begründen. Deine Frage würde ich mit ja, beantworten. Das "Metrum" ist nur die Leinwand, auf die der Dichter seine Verse malt! Was übrigens ein sehr treffendes Bild ist. Stammt es von dir selbst, oder ist es ein Zitat? Das Metrum wird nur benötigt, damit das "Farbenspiel" des Rhythmus oder der Phrasierung überhaupt in der Sprache "aufgetragen" werden kann. Ist die Leinwand zu grob oder gefaltet oder auf anderer Weise hervortretend, dann schmälert das die Schönheit und den Genuss des Gedichts. Man findet hierin übrigens auch den Grund für den wesentlichen Unterschied von Prosa und Lyrik und auch, warum wirklich gute "freie Lyrik" so schwierig ist. Liebe Grüße Thomas |
Du erinnerst Dich an meine Anmerkung zur Silbengewichtung abhängig von ihrer Funktion bzgl. des Aussagewertes? Genau das käme hier m.E. zum Tragen. Als Personalpronomen gehört "he" funktionsmäßig eher in die Senkung. Die Vokallänge rangiert hier für mich erst in zweiter Reihe (und anscheinend auch für Shakespeare, aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer). Und sooo lang ist das "e" in "he" ja auch gar nicht. Die Aussprache von "I" empfinde ich z.B. als länger.
Bei mehreren Einsilbern in Reihe kann man als grobe Richtschnur Moritz' Prosodie der einsilbigen Wörter verwenden. Natürlich schaue ich immer auf den Einzelfall, aber so ungefähr kommt es mit der Gewichtung eigentlich immer hin. Wenn eine Wortart in der Liste über einer anderen Wortart steht, ist ein Wort der ersten Wortart lang/betont gegenüber einem Wort der zweiten Wortart: Substantiv / Adjektiv Verb Interjektion Adverb Hilfsverb Konjunktion Pronomen Präposition Artikel Was soll ich denn widerrufen? Das "nicht saubere" Metrum? Das war doch in ein Kompliment gewickelt! Willste noch ein Blümchen dazu? Bitteschön! :Blume: Edit: Hallo Thomas, wir hatten uns gerade überschnitten. Bzgl. der Leinwand schließe ich mich Dir an. Das Metrum ist nur der Untergrund, und Dichten ist nicht "Malen nach Zahlen". ;) LG Claudi |
Nein, es geht auch ohne Blume.
Ich hatte verstanden, dass du Vers 5 nicht so wie ich lesen tust, zuerst, und dann deine Meinung änderst. Das nannte ich widerrufen (korrekter wäre: widerruft haben). Vers 3 hatte ich übrigens markiert, nur leider die X-e statt den Text. Er ist ein krasses Beispiel (könnte die französische Betonung von violet etwa eine Rolle spielen?). Auch mit dem happigen "past". Aber nun zu Vers 14: O.k., o.k., nett, was du anmerkst. Aber es bringt nichts Neues. Ich sag ja, dass das he nur so viel Gewicht erhält, weil es "him" meint, den Ungenannten, den nicht Benennbaren (denn wenn man ihn ruft, dann kommt er). Danke für die Moritzsche Liste. Sie würde aber, ist sie denn irgendwie sinnvoll, ebenfalls die Sicht unterstützen, dass in diesem Vers das "he" herausragend betont wird und deshalb der Iambus an dieser Stelle klar durchbrochen. Oder? LG wolo |
V5 lese ich auftaktig. Das ist der Unterschied. Den Hebungsprall hatte ich von Anfang an so gelesen, da gibt es nichts zu widerrufen.
Zitat:
LG Claudi |
vordergründig? deute hier keine hintergründe an, sonst wird's schwierig. ;-)
aber entschuldige, du hast natürlich recht. für mich stand dieses pronomen he so hoch oben über allem, dass ich nur das subsantiv "dahinter" sah. blinder eifer... lg wolo edit: "he" hat ein geschlossenes i. geschlossene vokale haben per se ein gewisses gewicht, egal, wie kurz du sie sprichst, meine ich. wenn du "auftaktig" ins Spiel bringst, liegst du m.e. voll daneben. man kann jeden iambus-vers als "auftaktig" bezeichnen. ein auftakt kann aber aus einer halben, einer viertel-, einer achtel-, einer sechzehntel-note bestehen, nicht wahr... "auftaktig" heisst damit gnichts oder nicht viel. |
... sagt der Mensch, dem die Verslehre egal ist. :D
Ja, der Jambus ist ein Maß mit Auftakt. Ich sehe ihn in V5 verwirklicht, Du offenbar nicht, wenn Du den Vers doppelt betont beginnen lässt. Auch das wäre (rein theoretisch) so eine metrische Lizenz im jambischen Vers. Ich meine, der Vers beginnt stinknormal mit Auftakt (= unbetont). Viertel- Achtel- und Hundertachtundzwanzigkommafünftelnoten habe ich dabei nicht berücksichtigt. Ist das Dein Ernst? :eek: Aber jetzt lass uns bitte über deutsche Gedichte reden. Da gibts bestimmt jede Menge guter Beispiele. Wenn ich Zeit habe, suche ich mal mit. LG Claudi |
mit ist verslehre nicht egal, wenn sie rational betrieben wird und nicht als glaubensbekenntnis!
ob ein iambischer Vers xX oder XX beginnnt, spielt in meinen Augen keine Rolle. wie lange dieser auftakt klingt, ist dabei nebensächlich. aber. man kann diese länge durchaus in notenwerten angeben. ich denke nicht, dass es hier grund gibt, mich nicht ernst zu nehmen. aber lass uns über deutsche gedichte reden. hier ein rilke-sonett, das mit dem iambus spielt, wie shakespeare es getan hat. du findest darin sicher alle möglichen "auftakte". aber wenn du schon begriffe aus der musik verwendest, spotte nicht über notenwerte. wie war es doch mit lyrik, mit sonetten? hatte das nicht alles mal was mit musik zu tun? o.k.,o.k., lassen wir rilke sprechen: Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr! Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren gelösten Wald von Lager und Genist; und da ergab sich, daß sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr schien klein in ihren Herzen. Und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, – da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Schönes Sonett, nicht? Sogar mit der ach so schlimmen Gruppierung von drei unbetonten Silben! Was wird da Agneta denken! (dunkelstem Verlangen) Und jeder Menge "metrisch unsauberer" Zeilenanfänge (unterstrichen), z.B. wenn man die Moritzsche Liste zu Rate zieht oder aus andern Gründen. Trotzdem ein Sonett? Schönen Abend wolo |
Zitat:
Zitat:
Ja, Rilke ist bestens geeignet! Schönes Sonett! Hier sehe ich dreimal die versetzte Betonung am Versanfang: "Tiere aus Stille", "sondern aus Hören" und "kaum eine Hütte". Das ist eine gebräuchliche rhythmische Variante, die man (nach meinem Geschmack) ausgiebig nutzen sollte. Der Rest, den Du unterstrichen hast, lässt sich für mich normal alternierend lesen (siehe Moritz). Bei drei unbetonten Silben hintereinander (darauf hat Faldi bereits mehrmals hingewiesen) wird die mittlere Silbe (rein formal) als Hebung gesetzt. Im Vortrag ist das aber kaum zu hören (wäre ja furchtbar!). Edit: Hab nochmal darüber nachgedacht, wie Du wohl darauf kommst, V5 When lofty trees I see barren of leaues, betont beginnen zu lassen. Weil "when" auch in den ersten beiden Versen, die es einleitet, betont gesetzt ist? Ich glaube, dieses dritte "when" ist absichtlich anders gesetzt als die ersten beiden, weil ja hier die versetzte Betonung in die Versmitte wandert und zu dem prägnanten Hebungsprall führt. Beim dritten Mal gibt es also eine Überraschung mit gesteigertem Effekt. So würde ich das deuten, aber vielleicht spinne ich auch. LG Claudi |
Hier hast du Wolo ein Sonett aus Rilkes Sonettzyklus an Orpheus ( 55)ausgewählt. Und du hast recht. Die Metrik entspricht nicht den Vorgaben eines Sonettes.
Schon zu Entstehungsszeiten wurde Rilke dafür kritisiert, weil er hier alle formalen Kriterien durchbricht, durch die zahlreichen Enjambements sogar die Versstruktur. Weder Kadenzen noch Metrik hielt er ein. Seine hohe Anerkennung, die er damals als Dichter genoss , erlitt einen kleinen Rückfall. warum er dies tat, weiß niemand. nur er alleine. Darüber streiten sich die Fachleute bis heute. da Rilke aber die Metrik beherrschte, was er in velen klangvollen Geichten bewiesen hat, kann man nur vermuten,dass er es hier absichtlich einsetzte, eben als Stilmittel, vielleicht auch angelehnt an Blankverse o.ä, um zu verstärken. Dies ist das, was ich immer sage: erstmal muss man die Metrik können, erst dann kann man sie einsetzen um zu akzentuieren. Man merkt direkt, ob jemand es bewusste einsetzt ( Brüche herbeiführt) oder ob er es aus Unvermögen tut. Hier sehe ich allerdings diese Varinate für mich persönlich nicht. Bestenfalls bei "Tiere". Bei "sondern "hingegen ist es einfach nur unschön falsch. Vielleicht hat er sich einfach mehr auf den phänomenalen Inhalt konzentriert, vielleicht wollte er protestieren. Wer weiß das schon. Mir gefällt dieser Zyklus von Rilke nicht, obwohl ich ein erklärter Fan von ihm bin, eben deshalb nicht, weil er im weiteren Zyklus immer mehr von der Formalie abrückt. Sprachlich sicher eines seiner Glanzstücke, formal eher nicht. Viele Dichter waren dieser Ansicht, z.B auch Musil. Sicherlich war das deutsche Sonett nicht so klar eingeordnet wie engl. oder franz. zur damaligen Zeit.Heute ist dies anders. Im Grunde, Wolo, kann man viel diskutieren, das tat man schon zu Rilkes Zeiten.Wir wissen nicht, weshalb er es so gemacht hat. Sicherlich kann man es aber nicht als Bestätigung dafür nehmen, dass Metrik "für die Katz ist". Aber selbst da muss man dann ehrlich sagen: jeder muss es so machen, wie er es meint. Wer Metrik beherschen will, muss sie lernen. Wer nicht, der muss es eben lassen. LG von Agneta |
Hallo zusammen,
ich habe mit Interesse diese Diskussion verfolgt und glaube zu verstehen, was du meinst, wolo. Zum Shakespeare-Sonett möchte ich mich nicht weiter äußern. Ich kann mich zwar gut in der englischen Sprache verständigen, doch würde ich mich auf gar keinen Fall hier auf eine Fachdiskussion einlassen. Warum Rilke seine Zeilen so geschrieben hat, kann ich auch nicht beantworten, vielleicht hat er einfach auf ein gleichmäßiges Metrum "gepfiffen". Es gibt noch etliche andere Texte von ihm in dieser Weise. Zum Thema Leinwand möchte ich mich Thomas' Beitrag anschließen, den ihr wahrscheinlich überlesen habt, ich finde, er hat das gut und bildlich dargestellt. Ein guter Freund von mir ist Musiker und wir haben oft über den Takt bzw. das Metrum diskutiert. Ein Takt besteht aus zwei Halb-,vier Viertel-, acht Achteltakten usw... Diese lassen sich auch noch untereinander kombinieren, so dass ein Takt z. B. auch aus zwei Vierteltakten und vier Achteltakten, und das auch noch alternierend, bestehen kann. Leider kennt die akzentuierende Metrik der deutschen Sprache keine langen und kurzen Takte, sondern nur mehr oder weniger betonte und unbetonte Silben, was die Kombinationsmöglichkeiten erheblich einschränkt. Wenn wir die fünf "Grundmetren" Jambus, Trochäus, Daktylus, Anapäst und Amphibrachys einmal näher betrachten, so finden wir dort alle regelmäßigen Kombinationsmöglichkeiten, die unsere Sprache hergibt, zunächst einmal gegeben. Die theoretischen Konstrukte dieser muss ich hier nicht näher erläutern, die sind uns wohl alle geläufig. Mit den "Grundmetren" sind die Optionen aber noch nicht erschöpft, denn es ist zudem möglich, auch diese noch untereinander zu kombinieren. Und wenn das sinnvoll gestaltet wird, ergibt sich trotz allem ein regelmäßiges "Metrikbild". Ich möchte das mal an einem kleinen Beispiel (Eigentext) verdeutlichen: Große Augen fragten stumm und kleine Tränen liefen, ging sie nach Elysium, weil sie die Engel riefen? XxXxXxX xXxXxXx XxXxXxX xXxXxXx Und wenn das hintereinander betrachtet wird, ergibt sich folgendes Bild absoluter Regelmäßigkeit, obwohl hier Tröchäen und Jamben abwechselnd kombiniert wurden: XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx Jetzt gibt es natürlich auch "betonungsmäßig" schwierige Worte, die sich aber im Fluss des jeweiligen Metrums manchmal durchaus arrangieren lassen, wenn z B. im Jambus oder Trochäus drei eigentlich unbetonte Silben aufeinander treffen und dann die mittlere von ihnen eine leichte "Erhebung" erfährt. Damit lässt sich schön experimentiern und spielen. Und jetzt noch einmal zum sogenannten Hebungsprall: Ich habe mit Claudi vielfach darüber diskutiert, dass es in der deutschen Metrik einen solchen eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht haben wir auch immer aneinander vorbei geredet, denn natürlich lässt sich ein solcher durchaus, z. B. im Pentameter konstruieren. Nun würde ich den Pentameter aber nicht unbedingt als ein regelmäßiges Metrum bezeichnen, sondern eher als Ausnahme, erscheint er doch praktisch nur im elegischen Distichon als zweiter Vers und wird damit zum Exoten. Kommt ein solcher Hebungsprall -wohlgemerkt- innerhalb einer Zeile vor, dann fällt diese Zeile definitiv aus dem regelmäßigen Metrum heraus, denn sie entspricht dann nicht mehr einer der fünf "Grundmetren". Ebenso verhält es sich, wenn innerhalb einer Zeile das Metrum, also die "Betonungsstruktur", gewechselt wird. Selbstverständlich kann und darf ein Dichter so arbeiten, aber er sollte sich dann auch nicht wundern, wenn ihm ein geübter Leser sagt, dass ihm dies aufgefallen sei. Ich weiß jetzt nicht, ob dich diese Erklärungen zufrieden stellen können, wolo, aber wenn ich dir aufgrund meines Metrikverständnisses mitteile, dass einer deiner Texte aus den vorgenannten Gründen eben keinen regelmäßigen Jambus etc. aufweist, dann stellt dies doch keine Belehrung oder direkte negative Kritik dar. Du musst ja dabei auch berücksichtigen, dass du dann vielleicht einen eigenen, ganz persönlichen "Sprachtakt" kreiert hast, den dein Leser erst einmal richtig erfassen muss. Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass ein Sonett, was o. a. Unregelmäßigkeiten in der Metrik aufweist, aus diesem Grunde nun kein Sonett mehr sei. Es gibt heute viele Abweichungen vom streng klassischen Sonett, warum also auch nicht eine solche? Nur sollte man das dann auch anmerken dürfen, ohne dass sich der entsprechende Autor auf den Schlips getreten fühlt. In diesem Sinne sag ich mal, probiert es aus und experimentiert, was "die Leinwand" hält. Liebe Grüße Falderwald |
Ich schlage vor, den folgenden Text einer metischen Analyse zu unterziehen:
Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Seele dringt Und mit urkräftigem Behagen Die Herzen aller Hörer zwingt. Sitzt ihr nur immer! leimt zusammen, Braut ein Ragout von andrer Schmaus Und blast die kümmerlichen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen 'raus! Bewundrung von Kindern und Affen, Wenn euch darnach der Gaumen steht- Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht. Viele Grüße Thomas |
Hallo Thomas
Erstens entschuldige bitte, dass ich deinen Beitrag übersehen hatte. Zweitens Danke für die neue Anregung. Hallo Falderwald Danke für deinenlangen Beitrag, den ich in Ruhe studieren will und für den Hinweis auf Thomas' Beitrag. Nun haben hier einige Leute mit Kenntnissen auf meine Frage geantwortet (ach ja, die war kein Zitat, der naheliegende Vergleich mit der Malerei ist von mir. Noch lieber hätte ich die Musik bemüht, aber da haben Claudi und ich ein Kommunikationsproblem...). Zählt man noch ferdi dazu, gibt es genügend Grund für mich, ein wenig weniger laut zu sein und erst mal nachzudenken, bevor ich weiter micht beteilige. (Ich wollte auch nicht eine Mituserin aus dem Forum vergraulen, tut mir Leid.) Allen einen schönen Tag wolo |
Zitat:
Das liegt stets in den eigenen Eitelkeiten begründet. Wenn es einen Grund zum Einschreiten gegeben hätte, dann wäre dies auch geschehen, also mach dir keinen Kopf. Dass es anders geht, haben du und ich bewiesen. Wir waren uns anfangs ja auch nicht grün. Wenn man aber beobachtet und bereit ist, ein wenig aufeinander zuzugehen, dann funktioniert dies auch unter vernünftigen Menschen. In diesem Sinne ;) Liebe Grüße Falderwald |
Auf solchen "Kram" stehe ich natürlich! :Herz:
Nur wäre es vermutlich einfacher gewesen, zunächst einen deutschen (oder schwyzerdeutschen) Text durchzuarbeiten. Ich glaube, Thomas steuert auch in diese Richtung ... Gut eignet sich Schiller, der relativ leicht zu verstehen ist und sich durchaus metrische Freiheiten erlaubt hat. Bei Shakespeare (oder den Shakespearen - keena weeß wat Jenaues ...) gibt es die Schwierigkeit, dass der Sprachgebrauch seiner Zeit heute nicht mehr üblich ist. Bei mir kommt hinzu, dass ich Englisch gut lesen, aber weniger gut sprechen kann. Und falls doch, mit hessischer Dialektfärbung. :eek: Erich Kykal würde ich ein Wissen um die alte Aussprache jedoch zutrauen. - Aber auch ich kann tierisch auftrumpfen: Shakespeare ist ja durch ein sehr umfangreiches Werk bekanntgeworden und geblieben, das in Blankversen (fünfhebigen Jamben) verfasst worden ist. Dieses System hat er auf seine nicht minder berühmten Sonette übertragen. Bitte klickt mal diesen Link an http://www.freiereferate.de/englisch...-sonettanalyse der ist wirklich weiterführend, kurz und informativ. Deine Frage, Wolo, nach dem Stellenwert des Metrums, hast du mit deinem schönen und passenden Bild bereits weitgehend selber beantwortet. Pseudointellektuell heißt das: Der Vers ist konkret, das Metrum abstrakt. Will sagen, dass Metrum ist der Bauplan, der einem Gedicht zugrunde liegt. In der Lyrik haben sich recht unterschiedliche Versprinzipien herausgebildet: - silbenzählend - quantitierend (Metrum wird durch die Kürze bzw. Länge der Silben bestimmt ( wie in der antiken griechischen und römischen Dichtung) -akzentuierend (Unterscheidung von Hebungen und Senkungen wie bei uns daheim - vom Barock bis heute) Geht es dir gar um die WELTherrschaft, geht Vers vor Metrum. Aber: Kein geübter Dichter wird ohne Not (s)einen Bauplan verwerfen, es sei denn es gibt inhaltliche Gründe (Eigennamen etc.) oder metrische Gründe - wenn z. B. verschiedene Geschwindigkeiten ausgedrückt werden sollen. Immer aber gibt es erkennbare Regelmäßigkeiten, selbst im Vers libre. Norm und Abweichung Zitat:
Der kann natürlich auch im Experimentellen liegen. Ich hoffe, dass ich ein wenig Nützliches zum Faden beitragen konnte und grüße freundlich nach allen Seiten Marcy |
Hallo Wolo,
Zitat:
Hallo Marcy, willkommen im Forum! Zitat:
LG Claudi |
Zitat:
Rilke "fühlte" seine Lyrik, und wer sie nicht ebenso erfühlen kann, wird über ihn diskutieren und ihm Fehler vorwerfen. Wie Thomas so richtig Goethe's Faust zitierte: "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nie erjagen!" Darum muss man Rilke um jeden Preis "richtig lesen" können! Die richtigen Stellen betonen, das Wiegen der Worte spüren usw. Einmal kaufte ich eine CD mit den besten Rilkegedichten, gelesen von Ulrich Tukur. Was freute ich mich! Doch als ich hören musste, was dieser unsensible Keucher daraus gemacht hatte, pfefferte ich das Teil halb gehört in den Mülleimer! Nicht mal umtauschen wollte ich dieses Unding, bloß vernichten!!!! Nein - Metrik ist weder absolutes Dogma noch lyrisches Allheilmittel. Sie ist ein Werkzeug wie andere auch. Ich selbst bevorzuge metrische Korrektheit, außer jemand kann so genial mit Sprache umgehen wie Rilke, sodass man die Fehler beim Lesen gar nicht als solche wahrnimmt. Aber wer schafft das schon wie ein Rilke?:Aua |
Zitat:
|
Das war für mich sehr interessant. Letztlich darf man also alles? Es gibt die Metrik, als eine Art Leinwand, aber die Genies können auch auf zerknitterte Leinwände (die dann ein Stilmittel sind) große Gemälde malen, während ich kleines Forendichterinchen in aller Bescheidenheit erst einmal das Malen nach Zahlen erlernen muss. Echt frustrierend irgendwie. :(
Thomas hat mE, ganz gleich, ob man nun für Strenge oder mehr Freiheit ist, ein treffendes Resumee aus der Diskussion gezogen: Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Seele dringt Und mit urkräftigem Behagen Die Herzen aller Hörer zwingt. Sitzt ihr nur immer! leimt zusammen, Braut ein Ragout von andrer Schmaus Und blast die kümmerlichen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen 'raus! Bewundrung von Kindern und Affen, Wenn euch darnach der Gaumen steht- Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht. (rein metrisch kaum einzuordnen oder irre ich mich da? Ich meine vier Hebungen zu erkennen, stimmt das? Darf man denn das?) Liebe Gruß charis |
Hi, charis!
Thomas zitiert hier den Faust von Goethe. Es ist wie in der Malerei: Die großen Namen haben es von der Pike auf gelernt, nur um sich - zumindest in der Moderne - wieder davon zu lösen. "Kunst" kommt von "können". Wenige sind intuitive Genies, die gute Kunst fertigbringen, ohne je über Metrik oder Perspektive, Reim- oder Farblehre gelernt zu haben, aber gerade jene machen sich selbst schlau - zB. Van Gogh in der Malerei! Es sind die Faulen, die glauben, ein paar Maulvoll Farbe über die Leinwand zu husten wäre schon eine große Idee oder ein neuer avantgardistischer Stil, der ihnen Unsterblichkeit garantiert!:rolleyes: Es sind die Faulen, die "moderne" Lyrik schreiben, weil sie klassische nicht fertigbringen und sich dabei als große Poeten in die Brust werfen, weil ja jeder behaupten darf, was er möchte!:rolleyes: Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, es gäbe keine "gute" moderne Lyrik - es ist hier nur leichter, so zu tun als ob. Ich habe das kleine Handwerkszeug hier in den Foren gelernt - eben soviel, wie ich brauche, um nicht sofort als lyrischer Idiot aufzufallen. Zu mehr fehlt mir allerdings das diesbezügliche Interesse, ganz ehrlich gesprochen. Ich bin nur hier, weil ich gern dichte und gern gute Gedichte lese, nicht um mit Wissen zu glänzen, das ich nie brauche. Fachleute sind nicht der Weisheit letzter Schluss! Michael Jackson hat den kundigsten Schönheitschirurgen vertraut, und was ist dabei herausgekommen? Auch in der Kunst sind es nicht die Pharisäer und Koryphäen, die man noch nach hundert Jahren liest oder in Museen ausstellt, sondern jene, die es und sich "erfühlten" und sich nie beirren ließen! Wie oft hat man mir gesagt, ich solle "moderner" schreiben, mein Stil wäre altbacken, verstaubt, geschraubt, unnatürlich usw. blablabla ... Ich habe weiterhin so geschrieben, wie es mir Freude macht, und heute habe ich wohl einen gewissen Namen in manchen Foren, auch wenn mir das ziemlich egal ist. Es geht letztlich immer nur um die Freude daran!:):Herz: LG, eKy |
Zitat:
Wer aber Lyrik mehr liebt als Forengedichte jemals hergeben können, kommt m. E. gar nicht umhin, sich mit deren theoretischen Grundlagen, ihrer Analyse und Geschichte eine Zeitlang zu befassen. Schon Homer beschäftigte sich mit derlei, und der große Aristoteles schrieb die erste mir bekannte Poetik, abgelöst von seinen begabtesten Nachfolgern. - Augenblicklich existiert keine allgemein gültige Poetik. Allerdings gibt es an den Universitäten (Literaturwissenschaft) von zeitgenössichen Autoren zureichend Veranstaltungen zu diesem Thema, um ihr Schattendasein zu beenden. Dort käme man mit Bemerkungen wie: "Ich schreibe halt aus dem Bauch heraus ...", "im mündlichen Vortrag kann ich das ein bisschen ziehen" etc. nicht weit. Ein paar Grundlagenwerke zu den Gattungen und zur Rede im lyrischen Text sind m. E. unabdingbar. Allein schon, um eine gemeinsame Sprache zu benutzen, wenn es um lyrische Kategorien geht, also zu wissen, was chavali beispielsweise meint, wenn sie vom Versmaß spricht. Dies alles schließt ja experimentelle Dichtung nicht aus, sondern ein (wie ich bereits oben anführte). Die Ansprüche der User sind sicherlich sehr verschieden. Rechtschreibung, Metrik, Takt - und Stilaspekte sind jedoch erlernbar. Wir alle könnten von den Ergebnissen dieser Bemühungen profitieren. Schöne Grüße M. |
Hi, M!
Das Problem mit solchen Allgemeingültigkeiten ist, dass sie die Freiheit auch immer ein Stückweit einengen. Mit der Zeit kommen immer mehr Regeln hinzu, weil die versierten Poeten neue Herausforderungen brauchen. Ein schönes Beispiel dafür sind die Sonettregeln: Am Beginn stand wahrscheinlich nur die Form von Quartetten und Terzetten im Verein. Bald kamen weitere Regeln hinzu: die umarmenden Reime, die Struktur von These, Antithese, Synthese, die unbetonten Auftakte, die weiblichen Kadenzen, die Vermeidung des Paarreims in den beiden Schlusszeilen, die Gesetze des Kranzes und sicher noch ein paar Einschränkungen mehr, die ich nie gehört oder schon wieder vergessen habe. All das schnürt ein enges artifizielles Korsett, in dem zwar durchaus dichterische Höchstleistungen möglich sind, das aber zugleich auch vieles ausschließt und außenvor hält, was das Sonett als Kunstform durchaus bereichern könnte! Auch viele sprachliche Möglichkeiten werden so verunmöglicht! Wird ein Korsett zu enggeschnürt, bleibt dem Träger irgendwann die Luft weg! Nur der Pharisäer, der starre Geist beharrt um jeden Preis auf solchen Grenzen, als wären sie in Erz gegossen und absolut unverrückbar. Nur wer Grenzen braucht, schafft sich welche - und immer neue! Ich bin der klassischen Sonettform durchaus nicht abgeneigt und versuche sie meist zu befolgen - aber wenn es mal nicht passt oder meine Kreativität andere Wege geht, nehme ich auch dies als wertige Leistung an und schere mich nicht um die stringente Befolgung dessen, was meine Vision kastrieren würde. Demgemäß erachte ich gesunden Menschenverstand und individuelle Bewertung der Lage auch in der Gesellschaft als wichtiger als eine robotische Befolgung von Gesetzen und Vorschriften. Leider können viele Geister diesen Schritt nicht tun, ja nicht einmal innerlich nachvollziehen! Bedauerlich. |
Hallo, Erich,
Sonette werden ja heutzutage vergleichsweise selten geschrieben und falls doch einmal, eher mit (zeitgenössischen) Variationen versehen. Hinzu kommt, dass metrische Schemata nicht für alle Gedichte gleichmäßig genau angegeben werden können. Sapphische Oden lassen sich bis in kleinste Kleinigkeit der metrischen Einheiten nachempfinden, in der Analyse auch erkennen: Strophenlänge, Zeilenlänge, Hebungen und Senkungen sind gleichsam "schicksalhaft" vorherbestimmt. Anders sieht es in der Tat bei Sonetten aus, die - wie von dir angeführt - bereits von Rilke u.a. bzgl. der Verslängen variert worden sind. Allgemein lässt sich sagen, dass die Lyrik germanischer Herkunft metrisch viel fixierter daherkommt als die romanische. Und Sonette gehören bekanntlich der romanischen Gattung an. Ein Bauplan besteht ja zunächst einmal unabhängig von seiner Erfüllung: Das Schema kann gleich bleiben, aber dennoch ganz verschieden klingen (Lautung im einzelnen). Innerhalb der Hebungen existiert zudem eine ganze Skala an Möglichkeiten - von klangvoll bist kaum spürbar, anderes klingt wiederum straffer, artikulatorisch deutlicher. Diese Verschiedenheiten sind bei guten Dichtern aber keineswegs zufällig, sondern Manifestationen eines viel umfassenderen Phänomens, des Rhythmus. Aus meiner Forenerfahrung haben Musiker deshalb viel weniger Schwierigkeiten, ein gut klingendes Gedicht zu schreiben als unmusikalische Menschen. - Auch unverbildeten Kindern kann man die Chose durch Händeklatschen relativ leicht beibringen. Das soll erstmal reichen ;) M. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr. |
Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
http://www.gedichte-eiland.de
Dana und Falderwald
Impressum: Ralf Dewald, Möllner Str. 14, 23909 Ratzeburg